Auf der Spur ewiger Chemikalien

Wegen ihrer praktischen Eigenschaften sind sogenannte PFAS-Stoffe allgegenwärtig. Welchen Schaden sie im menschlichen Körper anrichten, wird kontrovers diskutiert.
Zuerst sahen Forschende in den 1960er-Jahren bei Hasen und Ratten, was die neuartigen Substanzen bewirkten: Nachdem die Tiere damit in Kontakt kamen, dauerte es nicht lange, bis sich ihre Leber krankhaft vergrößerte. Die Chemikalien namens PFAS hatten da schon längst ihren Siegeszug um die Welt angetreten: Denn sie machen Regenschirme wasserdicht, in Pfannen brennt durch sie das Essen nicht an, Löschschaum wird damit besonders wirksam. Die Wissenschaft schaute dann auch auf Arbeiter in den Chemiefabriken – und stellte fest, dass sich diese Substanzen im Blut stark anreicherten.
Ein paar Jahrzehnte später beugten sich Prof. Dr. Dr. Monique M. B. Breteler und ihre Doktorandin Elvire Landstra über die alten Studien. „Als Epidemiologinnen kennen wir das Muster“, sagen die beiden heute, wo sich die negativen Schlagzeilen über PFAS wieder häufen: „Die Extreme fallen immer schnell ins Auge, in diesem Fall also die Fabrikarbeiter, die besonders hohen Dosen ausgesetzt waren. Aber wie sich eine Substanz auf die breite Bevölkerung auswirkt, das lässt sich nur schwer feststellen.“ Über Jahrzehnte fehlte dafür die Technologie; doch jetzt könnte es sie geben und die beiden Wissenschaftlerinnen des DZNE in Bonn wollen damit endlich diese Wissenslücke schließen.
Unverwüstliche Substanzen
PFAS ist der Oberbegriff für zahlreiche Substanzen, Fachleute sprechen die Abkürzung „p-fass“ aus: Das steht für „per- und polyfluorierte Alkylverbindungen“. Diese Stoffe sind für viele Bereiche sehr attraktiv: Denn sie weisen Wasser, Fett und Schmutz ab – für Lebensmittelverpackungen ist das ideal, aber auch für Zahnseide, Kosmetik und atmungsaktive Funktionsjacken. Schätzungsweise rund 10.000 verschiedene Substanzen aus der Kategorie der PFAS wurden inzwischen entwickelt. Neben ihrer chemischen Grundkonstruktion haben die Wundermittel eine weitere Gemeinsamkeit: Sie sind so gut wie nicht abbaubar. „Ewigkeitschemikalien“ werden sie deshalb auch genannt.
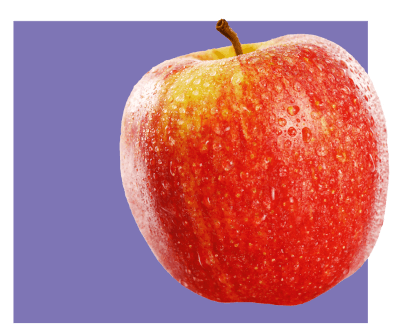

Modernste Technik
Monique Breteler und Elvire Landstra wissen, was diesen Chemikalien nachgesagt wird. Sie sollen Krebs erregen, das Immunsystem schädigen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen hervorrufen – die Liste ist lang. Und immer steht einschränkend dabei: Sie stehen „unter Verdacht“, diese Krankheiten auszulösen. „Unser Problem ist, dass sich die Kausalität nur schwer nachweisen lässt – dass also tatsächlich PFAS diese Krankheiten auslösen und es nicht nur Zufall ist, dass Patienten mit bestimmten Erkrankungen einen höheren PFAS-Spiegel im Blut haben. Aus bisherigen Daten lässt sich dieser Zusammenhang nicht klar ermitteln“, sagt Breteler. Die renommierte Professorin für Epidemiologie leitet am DZNE die Rheinland Studie, eine der weltweit tiefgehendsten Gesundheitsstudien. Ihre Überlegung: Mit modernen Technologien müsste sich die Beweiskette mehr und mehr schließen lassen – dafür nutzen sie sogenannte Metabolomics-Analysen.
Es sind Methoden, mit denen sich der menschliche Körper quasi auseinandernehmen lässt. So kann aus einer einfachen Blutprobe ein Datensatz gewonnen werden, der Tausende verschiedene Bestandteile aufführt. Wer das wiederum bei Tausenden Probanden macht, kann aus der Auswertung belastbare Zusammenhänge erkennen. Die Frage lautet: Welche im Blut messbaren Substanzen verändern sich besonders stark im Kontakt mit PFAS? Von da lassen sich Rückschlüsse ziehen auf Stoffwechseländerungen und Krankheiten, die durch die PFAS-Belastung hervorgerufen werden.
Der Weg in die Umwelt

Das Problem mit den Ewigkeitschemikalien ist, dass sie in die menschliche Nahrungskette gelangen. Über den Löschschaum von Feuerwehren kommen sie beispielsweise ins Grundwasser. Oder sie landen über Kratzer an der Beschichtung von Pfannen im Essen. Und vor einigen Jahren deckten Forschende aus Belgien und den Niederlanden einen großen Umweltskandal auf: Sie nahmen Wasserproben aus Flüssen, die in die Nordsee münden, vor allem aus der Schelde. Bei der Analyse waren die PFAS-Werte exorbitant hoch. Das Team stellte die Verbindung zum Werk eines Chemiegiganten her. Von dort müssen die Substanzen ins Wasser gelangt sein. Wer Fische aus der Region aß oder das dortige Leitungswasser trank, kam zwangsläufig mit den Chemikalien in Kontakt.
Vor diesem Hintergrund bekam Monique Breteler einen Anruf von Kolleginnen und Kollegen aus Leiden. Denn in den Niederlanden gab es einen neuen Skandal und ein Gerichtsverfahren, da ein anderes Chemiewerk ebenfalls große Mengen an PFAS produzierte und die Umwelt verschmutzte. „Daraufhin haben wir uns vorgenommen, gemeinsam aufzuschlüsseln, welche gesundheitlichen Auswirkungen diese Chemikalien haben“, sagt Breteler. Sie brachte einen Datenschatz in die Untersuchung mit ein: Blutproben von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Rheinland Studie. Über viele Jahre werden darin Tausende Erwachsene immer wieder untersucht, die einen Querschnitt durch die Bevölkerung bilden.
Starker Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen
„Wir haben zunächst gemessen, wie hoch die PFAS-Belastung im Blut der Probanden war“, erklärt Elvire Landstra, die die Daten analysierte. Monique Breteler erinnert sich noch gut an den Moment, als sie die ersten Ergebnisse auf dem Papier vor sich sah: „Ich war geschockt“, sagt sie: „Ich hätte nicht erwartet, dass wir so starke Ausschläge sehen: Bei allen Beteiligten haben wir durch die Bank hohe PFAS-Werte festgestellt, bei jüngeren genauso wie bei älteren!“ Besonders überrascht war sie, dass nahezu alle Studienteilnehmenden PFAS im Blut hatten. Die Stoffe sind allgegenwärtig, und niemand kann ihnen entkommen, so die Schlussfolgerung der Forschenden.

Und dann stellten sie weitere Auffälligkeiten fest. „Wir haben uns auch das Lipid-Profil der Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer sehr genau angeschaut“, berichtet Landstra. Lipide sind Fettstoffe; hier zeigte sich nun: Manche davon – sogenannte Metaboliten, wie das bekannte Cholesterin – kommen bei Probanden mit besonders hohem PFAS-Spiegel in stärkerer Konzentration vor. Dies ist zwar kein Beweis für einen ursächlichen Einfluss der PFAS-Chemikalien auf die Metaboliten, aber der statistische Zusammenhang ist dafür ein starkes Indiz. „Uns wurde schnell klar: Es sind genau jene Metaboliten, die in Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen stehen. Genau diese Metaboliten gelten als Risikofaktoren“, sagt Landstra. Dass sie in ihren Untersuchungen nur die Spitze des Eisbergs im Blick haben, wissen die Wissenschaftlerinnen: Denn sie konzentrierten sich auf die drei häufigsten PFAS-Sorten; vermutlich aber wirken die insgesamt rund 10.000 jeweils unterschiedlich; schon jetzt gibt es Hinweise darauf, dass manche stärker die Niere, andere stärker die Leber betreffen. Und womöglich gibt es auch noch Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Arten. Darüber hinaus haben die Forschenden bisher nur die Effekte von PFAS auf einen Bruchteil der verfügbaren Biomarker und Gesundheitsindikatoren betrachtet. Gerade planen Monique Breteler und Elvire Landstra die nächste Untersuchung – mit noch mehr Probanden und noch mehr Daten.
Viele Jahrzehnte nach den ersten verdächtigen Beobachtungen sieht es so aus, als könnte die Forschung die wahren Auswirkungen der vermeintlichen Wunderchemikalien allmählich lüften.
Das Forschungsmagazin „SYNERGIE – Forschung für Gesundheit" der Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung erscheint zweimal im Jahr als gedruckte Ausgabe und kann hier kostenlos abonniert werden.
Dieser Artikel erschien in der SYNERGIE-Ausgabe #1 | 2024
Text: Kilian Kirchgeßner
